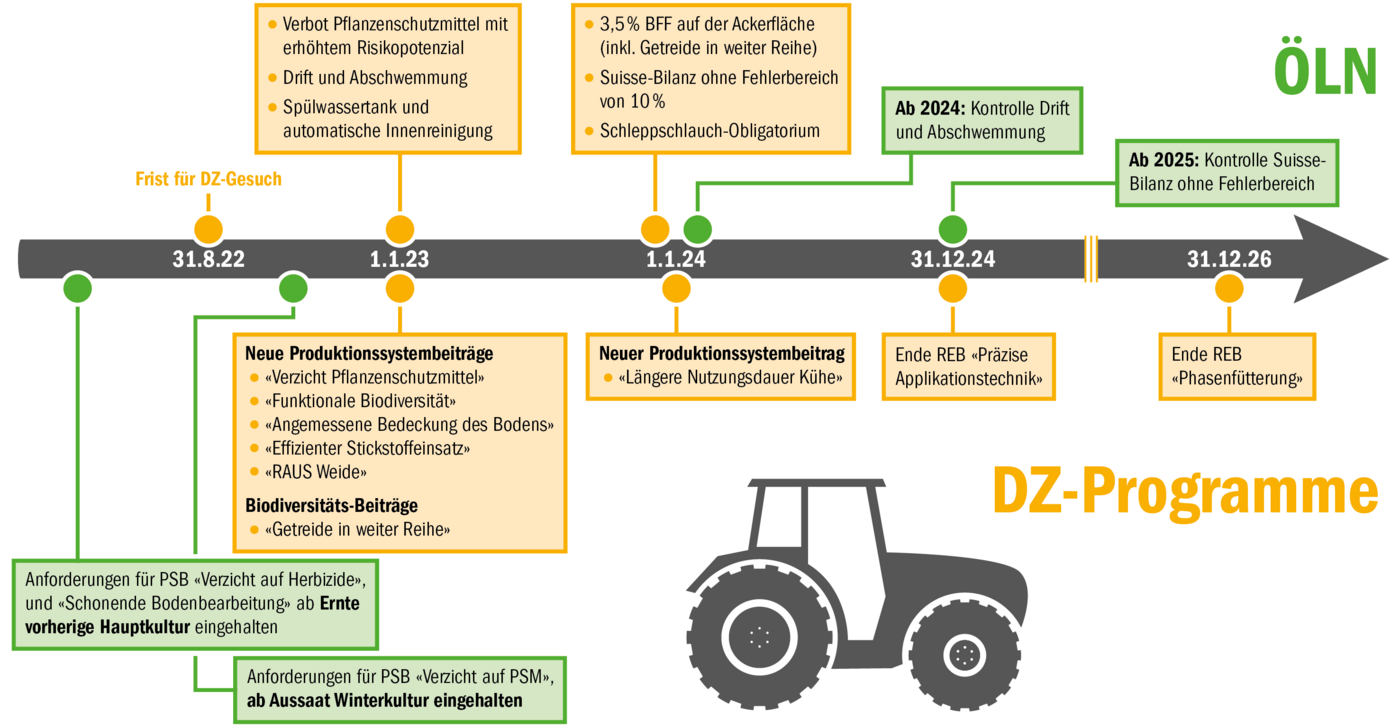Die Aufzucht von Färsen ist ein grosser Kostenpunkt und eine bedeutende Quelle von Emissionen. Da diese Jungtiere zwei bis drei Jahre unproduktiv sind, schlagen sich die Emissionen für die Aufzucht folglich auf die Anzahl der Laktationen nieder, die sie während ihrer produktiven Lebensphase machen. Wenn die Anzahl der Laktationen pro Kuh erhöht wird, werden gleichzeitig der Bedarf an Remonten und damit auch die…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 4 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.