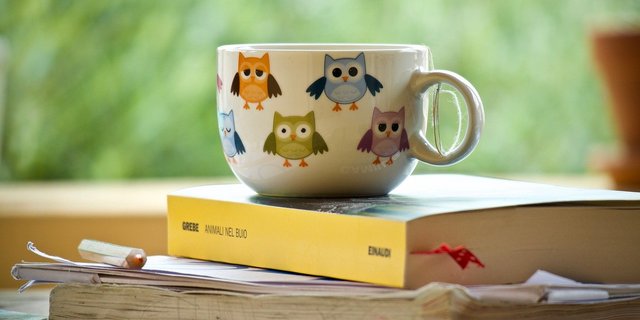Stress wird sehr unterschiedlich wahrgenommen. Diese Unterschiede zeigen sich beispielsweise bei den verfügbaren Arbeitsmitteln: lebensfähige oder renovierungsbedürftige Struktur, leistungsfähiger oder alternder Maschinenpark, erträgliche oder unzumutbare Übernahmebedingungen. Das weiss Jérémie Forney, Professor am Institut für Ethnologie der Universität Neuchâtel. Auch die Familiensituation und das Verständnis…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 3 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.