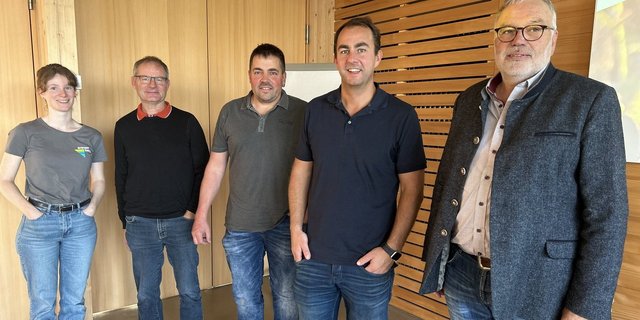Derzeit sind beim Verein Hochstamm Suisse 1510 Betriebe angemeldet – Tendenz steigend. «Wir wachsen stetig, es kommen jedes Jahr neue dazu», sagt Geschäftsführer Pierre Coulin. Insgesamt stehen in der Schweiz rund 225'000 Hochstämmer, die unter das Label fallen. «Wir bewegen uns damit bei etwa 10 Prozent aller Hochstammbäume in der Schweiz unter Hochstamm Suisse», bilanziert Coulin. Der Vorteil einer Mitgliedschaft…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 5 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.