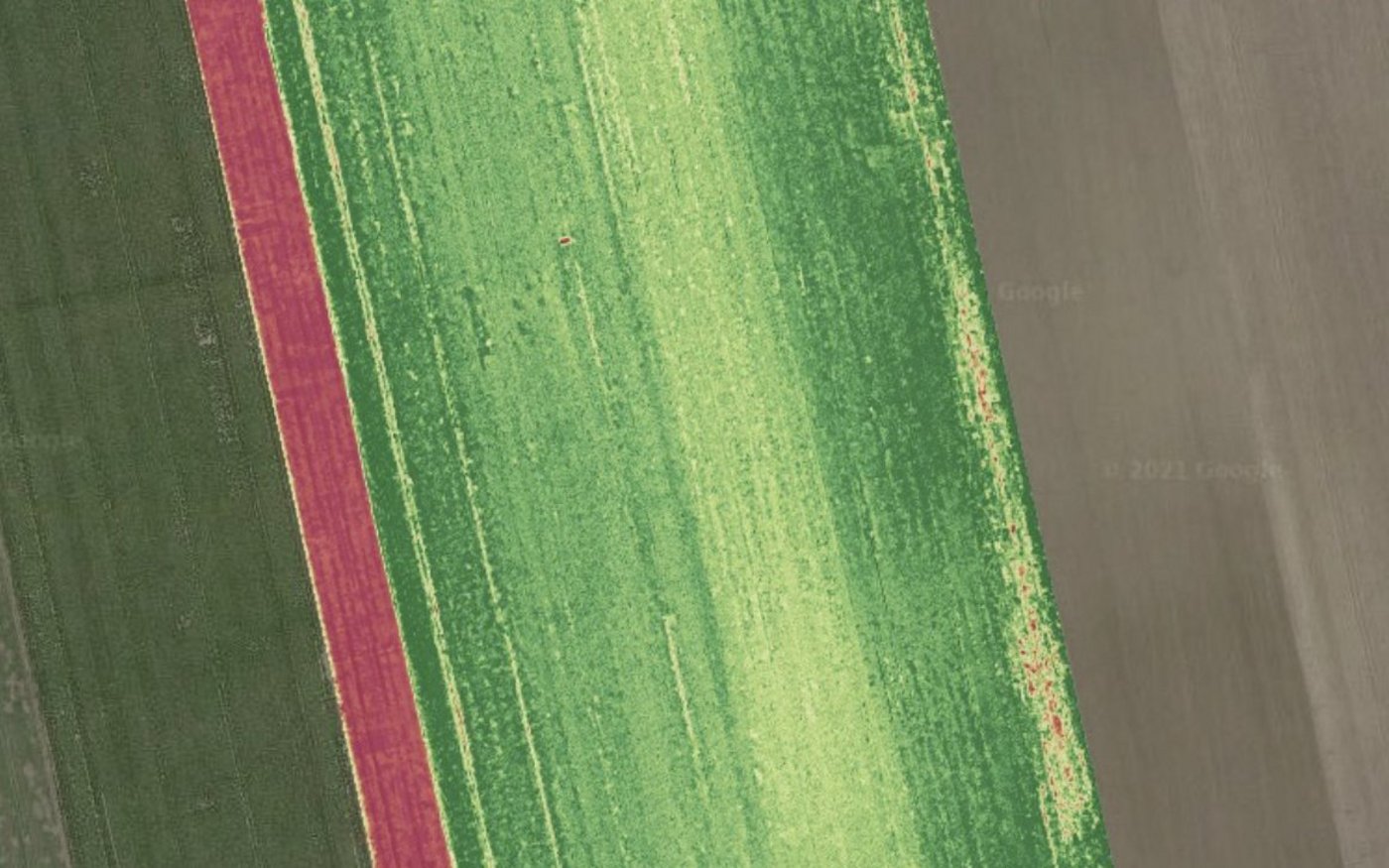Der Düngerpreis hat sich weltweit um das Dreifache erhöht. Zum Teil sind Düngemittel sogar schwer verfügbar, weil zum einen die Nachfrage in den letzten Jahren stark angestiegen ist und zum anderen Fabriken wegen der steigenden Erdgaspreise ihre Produktion herabsetzen oder gar einstellen mussten (wir berichteten). Eine Entspannung ist schwer vorherzusagen, hört man aus den Fachkreisen. Zudem steht die Düngung schon…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 5 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.