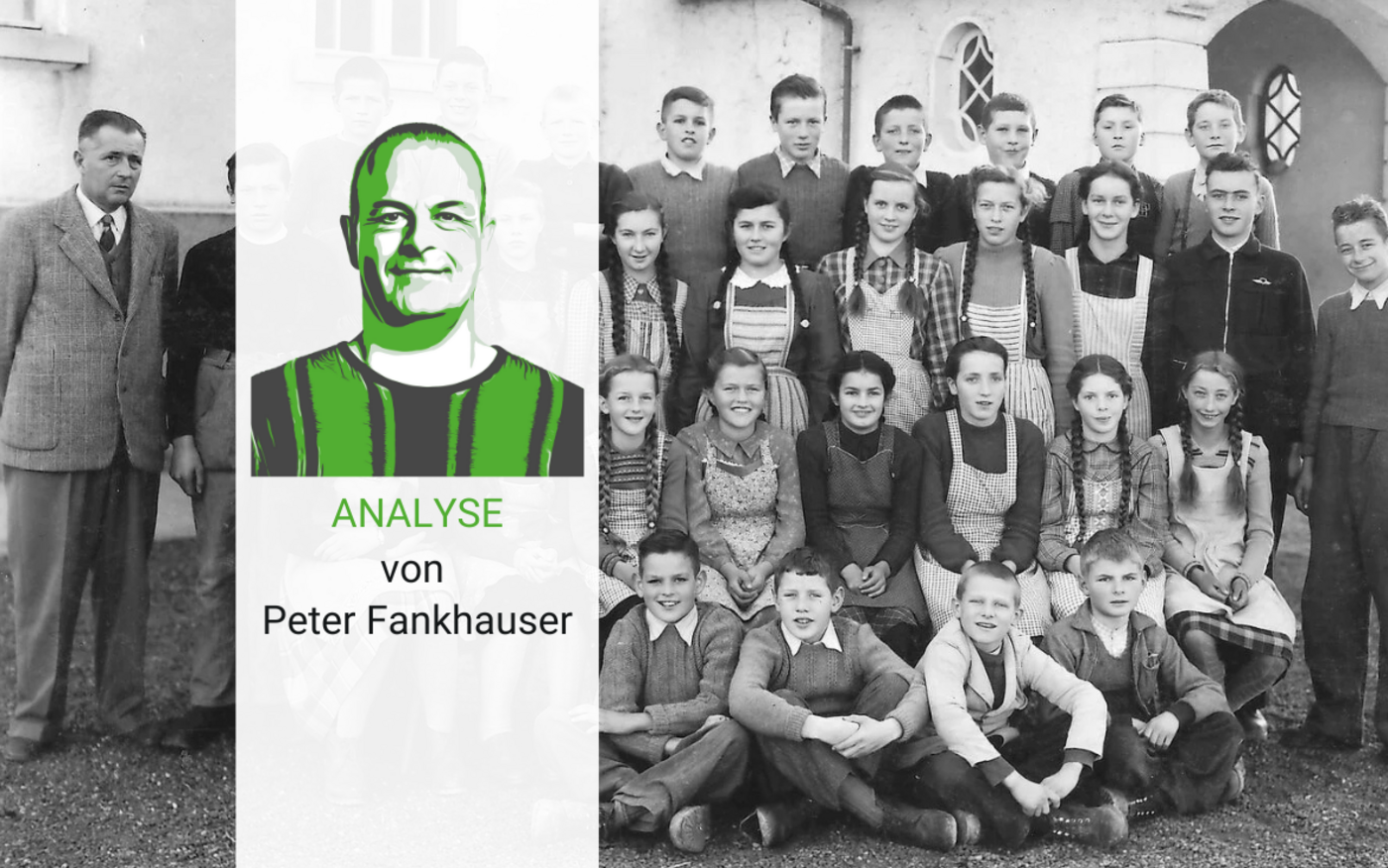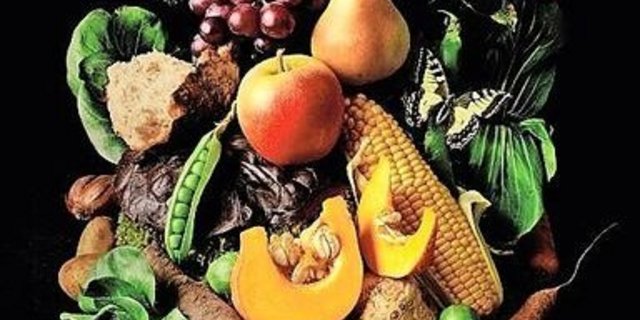Nein, mit Verdingkindern bin ich nicht aufgewachsen – meine Mutter, Jahrgang 1941, dagegen schon. Ich habe sie gefragt, wie sie das damals erlebt hat und wollte von ihr wissen, wie die Verdingbuben auf den Bauernhöfen behandelt wurden. Vor allem der Verdingbub «Wernu» sei ihr noch in Erinnerung geblieben. Während ich ihren Erzählungen lausche, schüttle ich bei einigen Sätzen nur den Kopf.
Wir reisen zurück in die 1940er- und 1950er-Jahre. Im Dorf Frieswil, im Bernbiet, ist meine Mutter aufgewachsen. Im Schulhaus in Matzwil ist sie zur Schule gegangen. Wernu war ein Klassenkamerad von ihr. Er war einer von acht Verdingbuben, die damals in Matzwil zur Schule gingen. «Wir nannten sie auch Käsereibuben, denn ihre Aufgabe bestand darin, morgens und abends mit den Hunden die Milch in die Käserei zu bringen», erzählt meine Mutter.
Ein böser «Cheib»
Der schüchterne Wernu war damals bei einem Bauern in der Gegend von Frieswil untergebracht. Der Meister sei ein böser «Cheib» gewesen, sagt sie. Wernu durfte nicht im Bauernhaus schlafen, sondern hatte neben dem Schweinestall sein Zimmer. Am Morgen vor der Schule musste er jeweils noch die Schweine füttern und den Stall ausmisten. Danach ging es mit dem Hund und der Milch in die Käserei. Fast 50 Minuten zu Fuss dauerte es, bis er von der Käserei wieder zu Hause war. Meistens reichte die Zeit dann nicht mehr aus, um zu frühstücken – geschweige denn, sich zu waschen – und noch rechtzeitig in die Schule zu kommen.
«Wir Kinder in der Schule haben immer zu ihm gesagt: ‹Fahr ab, du Stinkmore›», erzählt meine Mutter weiter. Niemand wollte neben Wernu sitzen. Nur die Lehrerin in der Unterstufe hatte Mitleid mit ihm. In der Pause gab sie ihm oft ein Butterbrot zu Essen – im Wissen, dass er noch nichts im Magen hatte.
Im Winter habe Wernu oft kalt in seiner Bude gehabt, denn geheizt wurde dort nie. «Är het viu is Bett bislet», berichtet Mutter vom Hörensagen. Wernu fror nicht nur, sondern hatte auch Stress. Das nasse Leintuch sei sicher oft am Abend noch nicht trocken gewesen, wenn Wernu wieder ins Bett ging. «Der Bauer hat ihn oft geschlagen – niemand konnte etwas tun, auch die Lehrerin nicht», sagt meine Mutter nachdenklich. Der Bauer sei nicht nur im Gemeinderat, sondern auch in der Schulkommission gewesen. «Früher war das halt so. Zum Pfarrer, zum Gemeinderat oder zur Schulkommission – zu denen hat man halt hochgeschaut und niemand durfte etwas sagen.»
Verdingbuben wurden besonders hart angefasst
Schlimm wurde es, als Wernu in die Oberstufe kam. Dort hatte ein jähzorniger Lehrer das Sagen. Der Lehrer mochte die Verdingbuben nicht – besonders Wernu war ihm ein Dorn im Auge. «Er ging oft mit ihm in den Keller, schlug ihn dort mit einem Stecken», weiss meine Mutter. Man müsse die Verdingbuben besonders hart anfassen, damit aus ihnen doch noch etwas werde, sei das Argument des Lehrers gewesen.
Oft seien die Buben verdingt worden, wenn zum Beispiel der Vater dem Alkohol verfallen war, ein Elternteil gestorben war oder man die Familie mit zehn und mehr Kindern nicht mehr ernähren konnte.
Vierzig Jahre später kam Wernu dann zum ersten Mal an eine Klassenzusammenkunft. Er arbeitete damals in einer Schokoladenfabrik und brachte jedem seiner ehemaligen Schulgspänli eine Schachtel Pralinen mit. Er erzählte, wie es ihm als Verdingbub ergangen sei. Er berichtete, dass er nicht nur vom Bauern, sondern auch vom Lehrer geschlagen und von seinen Mitschülern oft gehänselt wurde. «Mir heinis denn so gschämt», so meine Mutter. Nach diesem Klassentreffen sei Wernu nie mehr an einer Zusammenkunft erschienen.
Ein dunkles Kapitel
Der Bericht über Wernu ist mehr als eine individuelle Erinnerung – er steht exemplarisch für ein dunkles Kapitel der Schweizer Sozialgeschichte, das lange verdrängt wurde: das System der Verdingkinder. Die Schilderungen meiner Mutter zeigen eindrücklich, wie sehr dieses System von Machtmissbrauch, sozialer Kälte und öffentlichem Wegschauen geprägt war. Der Alltag der Verdingbuben – geprägt von harter Arbeit, physischer Gewalt, emotionaler Vernachlässigung und gesellschaftlicher Ausgrenzung – spiegelt eine Haltung wider, in der Armut, Herkunft und Schwäche als Makel galten. Was hier einzig hilft, ist das Wissen, dass es auch Verdingte gab, die es gut hatten.