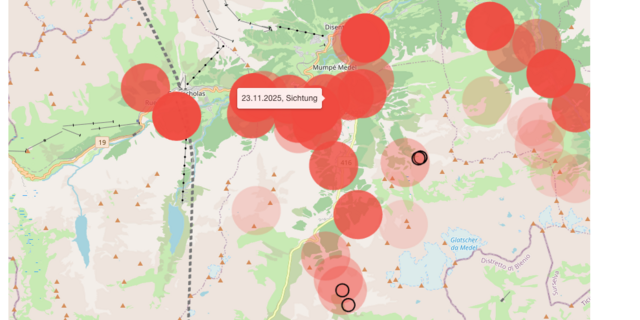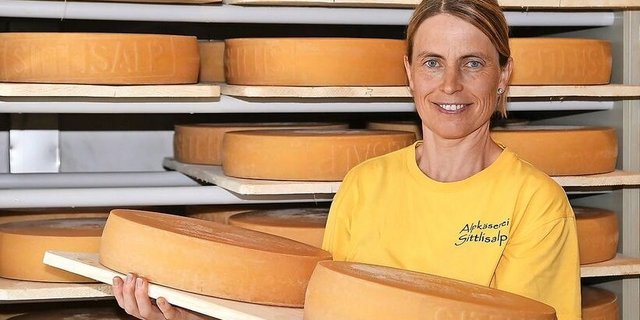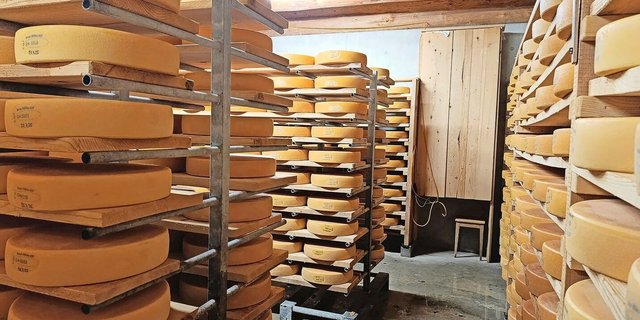Mit der proaktiven Regulierung von Wolfsrudeln ist der Bundesrat der Landwirtschaft in der revidierten Jagdverordnung (JSV) deutlich entgegengekommen. Rund drei Monate nach deren Inkraftreten zeigen sich nun aber auch die Schattenseiten des Regelwerks. Nicht alles, was in der Verordnung steht, ist im Interesse von Tierhaltenden und Alphirten.
TVD-Eintrag erforderlich
Der Schweizerische Alpwirtschaftliche Verband (SAV) hat deshalb zusammen mit dem SBV ein Merkblatt ausgearbeitet, in dem die wichtigsten Problemfelder definiert werden. Dazu gehört zunächst die Entschädigung von Wolfsrissen. Neu werden vom Bundesamt für Umwelt nämlich nur noch Risse in «geschützten Situationen» entschädigt. Auf nicht schützbaren Weiden gibt es nur beim ersten Wolfsangriff eine Entschädigung. Wird daraufhin kein Notfallkonzept angewendet – also eine Überführung in eine geschützte Weide oder gleich die Abalpung – werden Risse ab dem zweiten Angriff nicht mehr entschädigt. Dazu kommt: Tiere werden nur entschädigt, wenn sie in der Tierverkehrsdatenbank (TVD) registriert sind. Nach Tierseuchenverordnung muss die Registration aber erst rund einen Monat nach der Geburt vorgenommen werden. Hier sei es wichtig, die Tierhaltenden zu informieren, hält das SAV-Papier fest.
Ständige Behirtung reicht nicht
Von den Kantonen verlangen die Verbände, dass sie auch ohne Bafu-Beiträge Entschädigungen auszahlen und dabei auch verschollene und abgestürzte Tiere abgegolten werden. Verzwickt ist Sache auch bei der Frage, ab wann eine Herde als genügend geschützt betrachtet wird. Gemäss JSV gehören ständige Behirtung mit Nachtpferchen, Nachtweide oder Schlechtwetterweide nicht zu den für Schafe und Ziegen anerkannten Massnahmen – obwohl diese Massnahmen in der Direktzahlungsverordnung DZV anerkannt sind. Die Folge: Die Tiere gelten nur in der Nacht als geschützt und werden entsprechend entschädigt und an die Schadschwelle angerechnet. «Werden Tiere am Tag gerissen, wird nur entschädigt, wenn ein Notfallkonzept umgesetzt wird», warnen die Verbände. Dabei sei die ständige Behirtung mit Nachtpferchen oder Nachtweiden eine Massnahme, die auf vielen Alpen einfach umgesetzt werden könne. «Entsprechend sind viele Alpen betroffen», so das Fazit. Geändert werden könne dies aber nur durch einen erneuten politischen Vorstoss. Das «Notfallkonhzept» komme dabei in den meisten Fällen der vorzeitigen Abalpung gleich. «Die Gefahr ist sehr gross, dass Alpen in Gebieten mit hohem Wolfsdruck und schwierigen topographischen Bedingungen aufgegeben werden»
Nutzfläche ausgenommen
Ansetzen möchten die Verbände bei der Berechnung der Schadschwelle, aber der die Behörden eingreifen dürfen. Unverständlich sei etwa, dass dabei nur Risse im Sömmerungsgebiet angerechnet würden, solche auf landwirtschaftlicher Nutzfläche (NL) dagegen nicht. Überhaupt seien die Schadschwellen zu hoch und nicht effizient. «Beginnen Wölfe Herdenschutzmassnahmen zu umgehen, muss schneller reagiert werden können», heisst es im Papier. Die Kantone müssten die Abläufe beschleunigen – spätestens ab Erreichen der Schadschwelle.