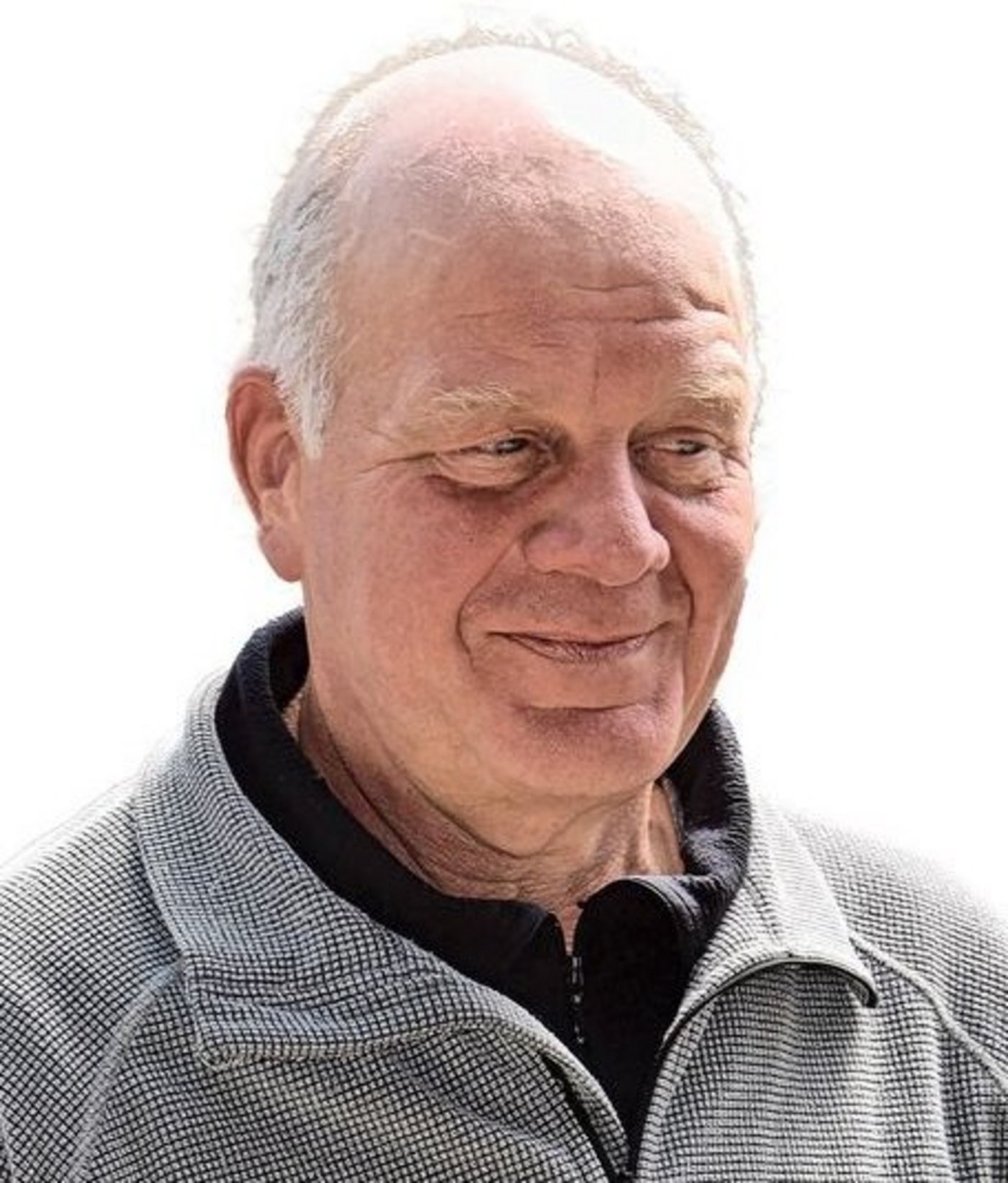Bei strömendem Regen, den dann und wann vom kalten Wind herangewehten Schnee im Gesicht, waren sich auf dem Baselbieter Farnsberg Landwirte, Naturschützer und Berater einig: Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren beim dortigen Naturschutzprojekt ist dessen Freiwilligkeit. Die Zahlen zum 20-Jahr-Jubiläum des Obstgartens Farnsberg machen deutlich, dass es den Beteiligten keineswegs an Engagement gefehlt hat. Kein Druck…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 6 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.