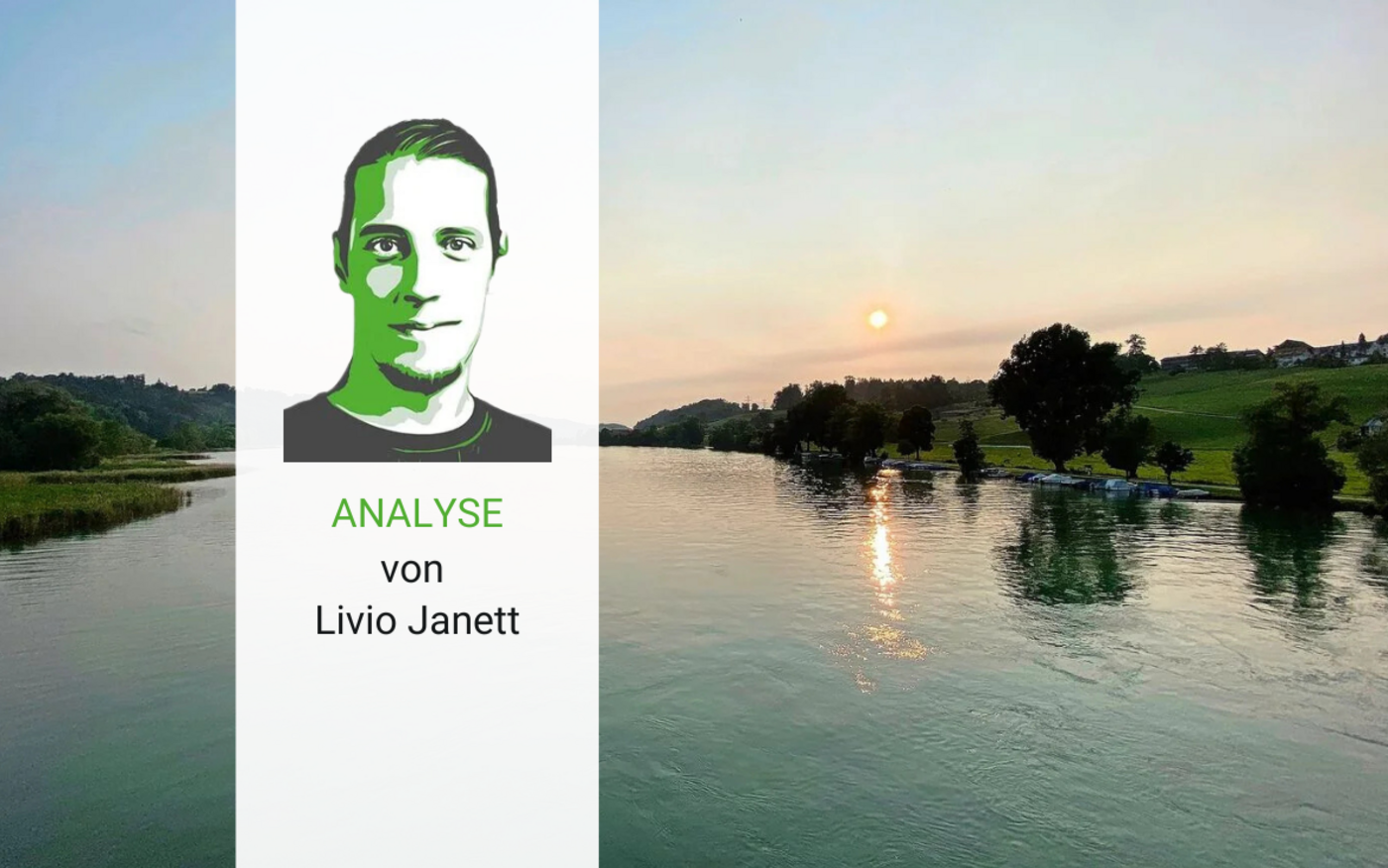Aktuell ist das Thema PFAS in aller Munde. Und so ärgerlich – und erschreckend – es auch ist: PFAS sind wohl wirklich in aller Munde. Immerhin stecken die auch als «Ewigkeitschemikalien» bezeichneten Stoffe in unzähligen Produkten, Geräten und Werkzeugen des täglichen Bedarfs. Sie sind in wasserabweisenden Textilien verarbeitet, in Beschichtungen und Imprägniermitteln, in Feuerlöschschaum enthalten und sogar in Duschgels und Kosmetika. Die Liste liesse sich noch nach Belieben verlängern.
Gelangen diese chemischen Verbindungen übers Wasser in den Boden, verbleiben sie da quasi für immer. Ein Blick auf eine Karte, die das Schweizer Fernsehen SRF gemeinsam mit anderen Medien erarbeitet hat, zeigt: In allen mehr oder weniger dicht besiedelten Gegenden Europas sind die Böden und das Wasser mit diesen Chemikalien belastet. Besonders hohe Konzentrationen gibt es gemäss dieser Karte in Belgien, Teilen der Niederlande und Deutschlands, in Dänemark und in Nordostitalien.
Die Diskussion entflammt
Ein weit verbreitetes Problem also. Entsprechend wurde das Thema in der jüngeren Vergangenheit immer wieder medial aufgegriffen. In Deutschland und Dänemark stellte man im Februar fest, dass die Konzentration im Algenschaum entlang der Meeresküsten dem 4000-Fachen der Grenzwerte entspricht. Im Mai wurde in der grenznahen französischen Region Elsass das Trinken von Hahnenwasser für Risikogruppen wie Schwangere verboten. Der Grund: Über den Löschschaum des Flughafens Basel-Mülhausen gelangten PFAS ins Grundwasser. Hierzulande standen in der jüngeren Vergangenheit etwa die Dämpfe von Skiwachsen in der Kritik, vor Kurzem entflammte die Diskussion über PFAS mit der Entdeckung von belastetem Fleisch in der Ostschweiz.
Seit den 1970er-Jahren wurden PFAS in der Industrie immer häufiger eingesetzt. Zum ersten Mal sorgte ein PFAS-Skandal Ende der 1990er-Jahre in den USA für Schlagzeilen. Kontaminiertes Wasser aus einer Teflonfabrik wurde unzureichend gefiltert und anschliessend in einen Fluss geleitet. Die Folge: Ein Landwirt in unmittelbarer Nähe zu besagtem Fluss verlor zahlreiche Rinder und Kühe wegen Vergiftungen. Die Folge war der «Teflonskandal», bei dessen Aufarbeitung ein Zusammenhang zwischen PFAS und Krebs und chronischen Krankheiten offenbar wurde. Manche langkettige PFAS reichern sich unter anderem in Fetten an und somit ausgerechnet in unseren Körpern – das ist ein riesiges Problem, das man nicht wegdiskutieren kann und nicht verharmlosen darf.
Eine «tickende Zeitbombe»?
Das Schweizer Fernsehen spricht im Zusammenhang mit PFAS auch von einer «tickenden Zeitbombe». Zyniker könnten angesichts dessen sagen: «Unsere Grossväter wurden von Asbest vergiftet, unsere Väter durch bleihaltige Farben und Stoffe, und unsere Generation erwischt jetzt halt Mikroplastik und PFAS.» Eine kurzsichtige Haltung, denn: Bauern denken bekanntlich in Generationen. In der Tat sind viele Flächen nicht erst gestern mit PFAS belastet worden. Viele «Sünden» liegen eine Generation zurück und wurden seinerzeit mit bestem Wissen und Gewissen «begangen». Wer vor dreissig Jahren Klärschlamm ausbrachte, konnte nicht ahnen, welche Stoffe sich darin verbargen. Die Suche nach Schuldigen ist deshalb in vielen Fällen müssig.
Schauen wir in die Ostschweiz: Hier sind zwischenzeitlich Landwirte an den medialen Pranger gestellt worden, die kaum Schuld an den PFAS-Belastungen haben. Es ist deshalb wichtig und nichts anderes als fair, dass man sie nicht zu Sündenböcken macht. Sie brauchen im Gegenteil Unterstützung und Sicherheiten angesichts der Folgen, die das Ganze für sie und ihre Betriebe haben könnte. In dieser Situation dürfen sie nicht allein gelassen werden. Einen ersten Schritt dazu scheint man in St. Gallen zu wagen. Der Kanton hat sich zur Finanzierung von Massnahmen bereit erklärt. Auch der Bund prüft einen Aktionsplan. Es ist ein gutes Signal an die betroffenen Bauernfamilien, dass bei diesen Bestrebungen der Erhalt der Produktion als oberstes Ziel gilt.
Vertrauensverlust kann sich niemand leisten
Gleichzeitig ist klar, dass diese Belastungswerte gesenkt werden müssen. Und dass mit allenfalls belasteten Lebensmitteln kein Schindluder getrieben werden darf. Alle Akteure in der grünen Branche müssen sich bewusst sein, dass der Fokus der Gesellschaft für die PFAS-Problematik inzwischen geschärft ist. Die Pflanzenschutz-Initiativen vom Anfang des Jahrzehnts lassen grüssen. Wenn wir die Konsumentinnen und Konsumenten also dazu «erziehen» wollen, dass sie regional einkaufen, sich am besten lokal verpflegen, dann müssen diese Lebensmittel strengen – und zuweilen auch aktualisierten –Richtlinien entsprechen. Alles andere führt zu Vertrauensverlust, den sich niemand leisten will und kann.