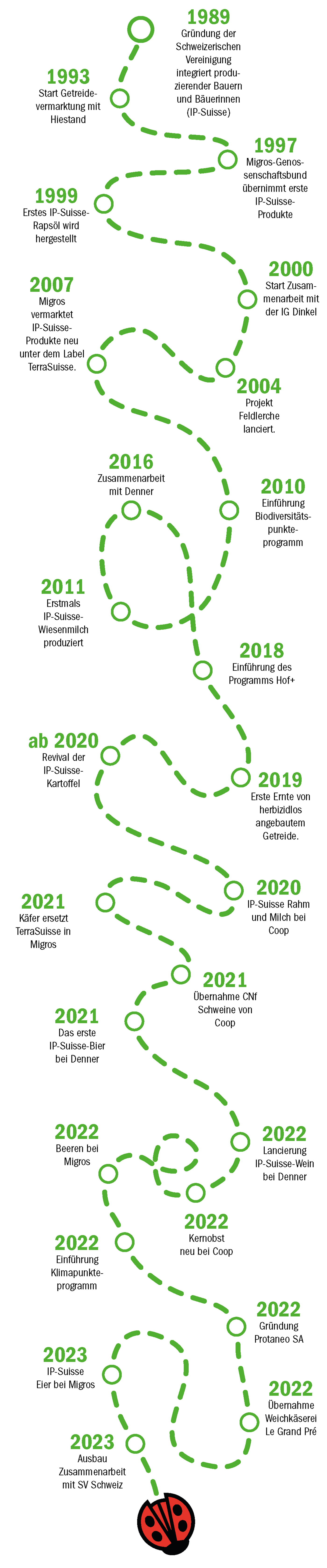[IMG 3]Die IP-Suisse hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben. Doch dieses Bemühen gerät, unter anderem durch den Ukraine-Krieg, zunehmend unter Druck. Die Bauernfamilien sollen zwar mit möglichst viel Rücksicht auf die Umwelt produzieren, aber kosten soll es nichts. Das nagt an der Stimmung der Produzenten. Wir haben Andreas Stalder, den langjährigen Präsidenten der IP-Suisse, getroffen und mit ihm über diese…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 9 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.