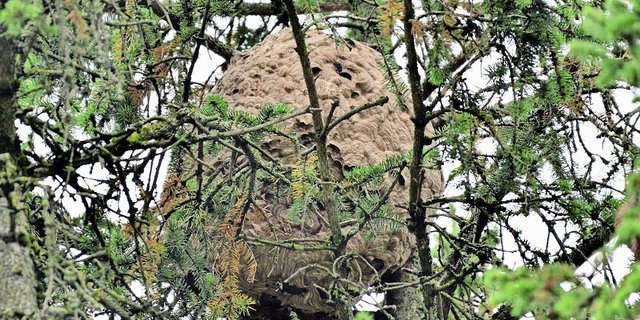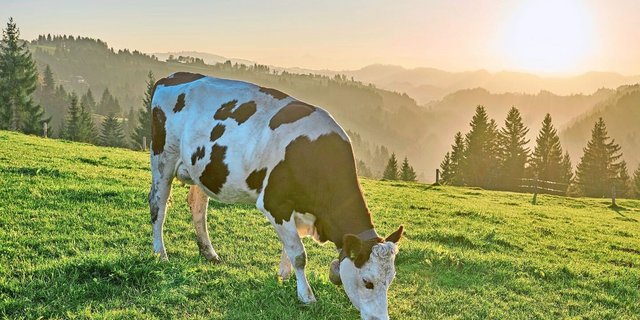Singzikaden führen ihr Leben mehrheitlich im Verborgenen und unbemerkt: Mehrere Jahre bleiben sie als Larven unter der Erde, nur zwei bis drei Wochen sind sie als erwachsene Insekten an der Oberfläche. In dieser Zeit singen die männlichen Tiere, paarungsbereite Weibchen antworten mit einem Flügelklicken. Diese Geräusche erklingen aber zunehmend seltener in der Schweiz, wie die kürzlich publizierte Rote Liste der…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 3 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.