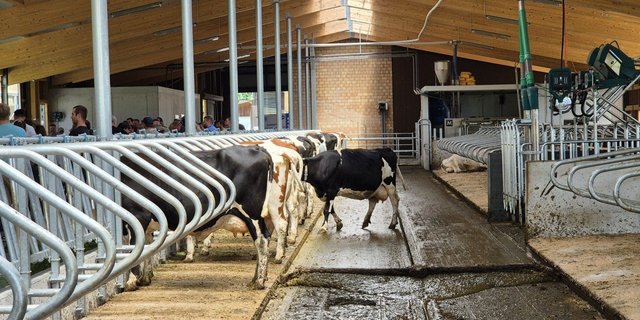«Wir mussten uns fragen, ob wir wirklich nochmals in die alte 120-jährige Scheune investieren sollen», sagt Armin Ambühl vom Betrieb Schwande in Wolhusen. «Für mich war die Antwort klar nein.» Zwar wurde vor 25 Jahren ein Laufstall eingebaut, damals noch für 20 Kühe, heute stehen in der Scheune 38 Kühe. Das Jungvieh wurde inzwischen ausgelagert, vor zwölf Jahren dafür eine ehemalige Schweinescheune zum Jungviehstall…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 7 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.