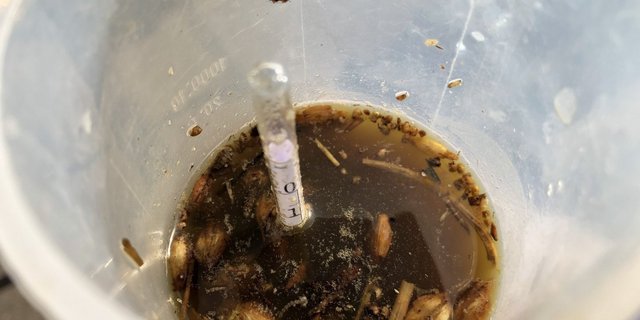Wie kann Hofdünger sinnvoll verarbeitet werden? Gibt es noch andere Wege für den Klärschlamm, als nach der ARA verbrannt zu werden? Das Thema des Workshops lautet «Hofdünger effizient nutzen». Es ist eine Fortsetzung des letztjährigen Anlasses mit derselben Thematik. Cristof Dietler, Geschäftsführer der IG Agrarstandort Schweiz (IGAS), knüpft kurz an den letztjährigen Workshop an: Er thematisiert die Aktivitäten…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 4 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.