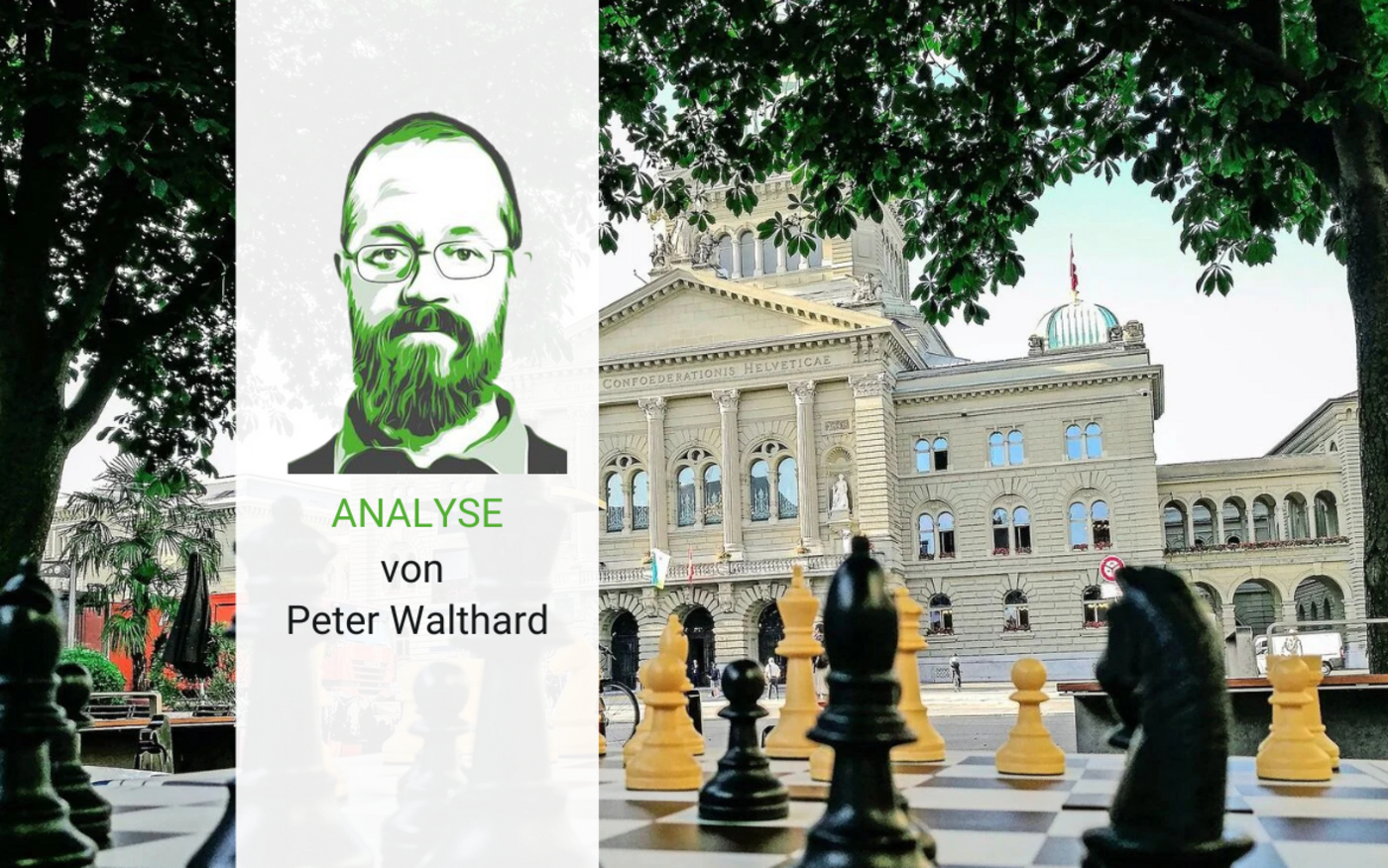Ende Semester, und das Kind kommt verdächtig gut gelaunt nach Hause. Es gab Zeugnisse. Alles gut gelaufen, meint die ehrgeizige Schülerin beiläufig, zeigt ein Klassenfoto, auf dem alle fröhlich sind, auch die Lehrerin. Und die Resultate? Alle gut. Sehr gut sogar. Darf man das Zeugnis sehen? Nein, noch nicht. Später vielleicht. Allenfalls das Gotti. Aber der Vater am besten gar nicht. Wer da nicht misstrauisch wird?
Ein bisschen ähnlich wie die Schülerin im Beispiel verhält sich derzeit unsere Landesregierung. Kurz vor Weihnachten kam das Klassenfoto: EU-Zarin Ursula von der Leyen hielt Hof zu Bern, empfangen von Bundesrätin Viola Amherd, die ihre Hände hielt, als hätte diese sie zum Handkuss ausgestreckt. Wenige Wochen später verliess Amherd die Kommandozentrale in Bern. Bei der Bestimmung der Nachfolge stellte die Parlamentsmehrheit sicher, dass der bisherige Kurs gewahrt werden würde: Markus Ritter, der angekündigt hatte, die Verträge mit der EU kritisch anzuschauen, wurde kurz vor der Wahl in die Nähe der SVP gerückt und damit unwählbar. Statt seiner kam Martin Pfister. Laut einem «Leak», das von SVP-Fraktions-Chef Thomas Aeschi auf X verbreitet wurde, soll dieser nun zusammen mit Aussenminister Ignazio Cassis sowie den beiden Linken Elisabeth Baume-Schneider und Beat Jeans dafür gesorgt haben, dass eine Volksabstimmung über die Verträge – stattfinden würde sie laut von CH Media kolportierten Einschätzungen einflussreicher Polit-Insider wohl erst 2028, also nach den Wahlen – nicht dem Ständemehr unterliegt. Damit stiegen die Chancen, dass die Bilateralen III dereinst vom Souverän abgesegnet werden, massiv, und das noch ganz ohne mühsame Überzeugungsarbeit in den traditionell EU-kritisch eingestellten Landkantonen. Gegen dieses Vorhaben ausgesprochen haben sollen sich die beiden SVP-Vertreter Albert Rösti und Guy Parmelin sowie FDP-Frau Karin Keller-Sutter – dies, obwohl anlässlich des Begräbnisses von Papst Franziskus in Rom fotografisch festgehalten wurde, dass auch sie Ursula von der Leyens Hände mit derselben demutsvollen Geste ergreift wie weiland Amherd.
Erinnerungen an den Europäischen Wirtschaftsraum
Doch das sind Details, Schmonzetten im Vorfeld eines Richtungsentscheides, der wohl nur mit der Abstimmung über den Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum EWR am 6. Dezember 1992 zu vergleichen ist. Einem Tag, der die politische Landschaft der Schweiz über Nacht verändert hatte und die Politik der letzten drei Jahrzehnte prägte wie keine andere. Vor dem vom unterlegenen FDP-Bundesrat Jean-Pascal Delamuraz so benannten «schwarzen Sonntag» war man sich in Bern von links bis rechts einig gewesen, dass kein Weg an einer engeren Anbindung an das europäische Projekt vorbeiführe. Dem Volk wurde indes weisgemacht, mit den Verträgen verändere sich so gut wie nichts, die Souveränität der Schweiz werde auf keine Weise beschränkt, der EWR und die Vorläuferorganisation der EU, die Europäische Gemeinschaft (EG), seien zwei völlig verschiedene Baustellen. Bis Ausnahmebundesrat Adolf Ogi, dem das Sprechen in den geschmeidigen Zungen der Mächtigen bis zuletzt fremd geblieben war, im falschen Moment ausplauderte: Der EWR diene als «Trainingslager» für den EG-Beitritt. Sein Zürcher Parteikontrahent, ein gewisser Christoph Blocher, rief derweil zum Aufstand der ländlichen Schweiz, Treicheln und Stumpen inklusive – und gewann.
Im Nachhinein war man sich einig. Es hätte eine ehrlichere Kommunikation gebraucht, mehr Transparenz, man hätte das Volk ernst nehmen sollen. Dieser Weg wurde bei den folgenden Abstimmungen über die bilateralen Verträge gesucht, wenn auch im Fall der Personenfreizügigkeit die Zuwanderung im Abstimmungskampf auffällig krass unterschätzt wurde. Immerhin ging es nun – sehr zum Leidwesen der in Organisationen wie Neue Europäische Bewegung Schweiz (Nebs) um Ökostrombaron Eric Nussbaumer (SP, BL) oder später der zuletzt mit einem Pulverdampf- und Pistolenskandal in Erscheinung getretenen Operation Libero organisierten Euroturbos weniger europhorisch zu und her. Im Grossen und Ganzen wurden die Bilateralen I und II dem Volk als notwendiges Übel verkauft, als ein Preis, den das Land zahlen muss, wenn es sich nicht völlig isolieren will vom übermächtigen Nachbarn.
DIe Bevölkerung hat sich seit 1992 verändert
Nun scheint sich etwas geändert zu haben. Über die Gründe kann man nur spekulieren. Setzen die Befürworter einer Annäherung an die EU auf die Macht der Demografie? Die räumliche Verteilung der Bevölkerung hat sich seit der Abstimmung von 1992 ebenso geändert wie ihre Zusammensetzung: In ländlichen Gebieten lebt heute nur noch ein kleiner Teil der Bevölkerung, der weitaus grössere haust in Agglomerationen, urbanisierten Ortschaften und Städten. Und von ihm stammen nicht wenige Vertreter, vor allem in den meinungsbildenden Schichten, aus EU-Ländern, namentlich Deutschland. Werden sie anders abstimmen als das Stimmvolk von 1992?
Die parlamentarische Delegation der Schweizer, die diese Woche in Brüssel eintraf, wurde nur von wenigen EU-Parlamentariern empfangen. Das sei ein Zeichen dafür, dass das Schweiz-EU-Dossier nicht auf der Prioritätenliste der EU stehe, sagte Mitte-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter zu Radio SRF.
In Brüssel, wo man sich mittlerweile ernsthaft darüber Gedanken macht, schon im Jahr 2029 einen grossen Krieg im Osten zu führen, hat man mittlerweile andere Sorgen. Vielleicht hat die Geheimniskrämerei und Taktiererei der Regierung diesmal einen ernsten Hintergrund. Vielleicht ist man in Bern zum Schluss gekommen, dass die Schweiz angesichts des rauen Windes, der nun in Europa weht, ohne Anpassung nicht mehr bestehen kann und dass ein zweiter «schwarzer Sonntag» vermieden werden muss – und zwar um jeden Preis.