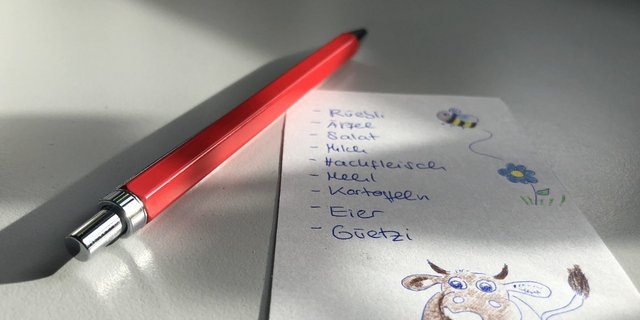Seit gut 100 Tagen ist der Waadtländer Cédric Moullet (49) Leiter des Direktionsbereichs Digitalisierung und Datenmanagement im Bundesamt für Landwirtschaft (BLW). Wir wollten von ihm wissen, wo die Digitalisierung in der Landwirtschaft steht und wie er die Kritik der Bauern kontert. Herr Moullet, Sie waren für das Covid-Zertifikat und die Digitalisierung des SAC verantwortlich. Wie hat es Sie in die Landwirtschaft…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 8 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.