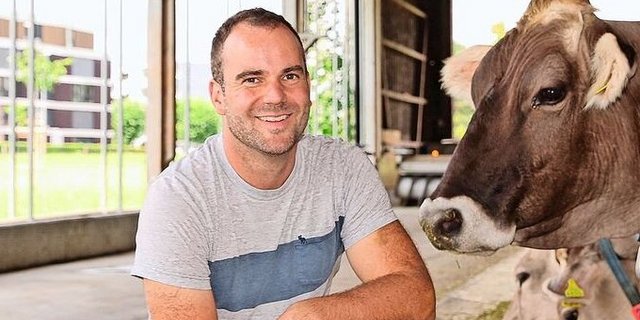«Da möchte ich nicht alleine alles im Kopf behalten müssen», meint Madlen Weyermann zu den immer grösser werdenden Betrieben in der Schweiz. Der Strukturwandel schreitet fort und die Belastung für die Bauernfamilien steigt. Mit der Ferme du Joran in Orbe VD geht Weyermann einen anderen Weg, und zwar zusammen mit einem Dutzend Mitstreitern. Kein Betrieb zur Übernahme Als die gebürtige Bernerin ins Welschland kam,…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 5 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.