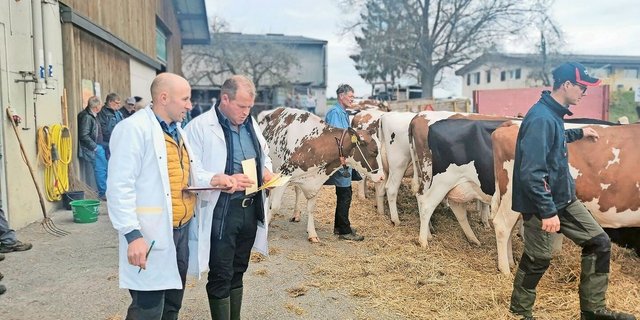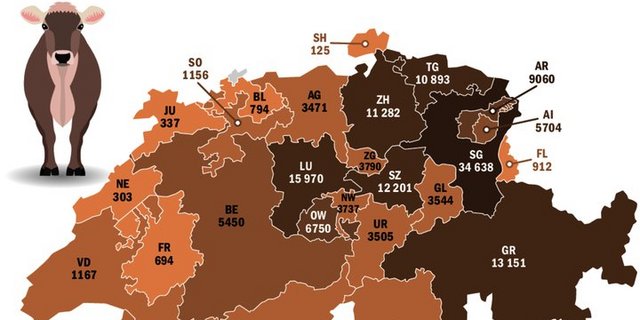Der Selbstversorgungsgrad und die Volksinitiative sind zwei der grossen agrarpolitischen Schlachtrösser, die regelmässig aus dem Stall geholt werden, um politischen Druck zu erzeugen. Zuletzt hatte die SVP, bzw. deren Vertreter Marcel Dettling und Esther Friedli im vergangenen Jahr eine Initiative zum Thema Selbstversorgungsgrad in Aussicht gestellt. Um das Projekt ist es nun aber still geworden und selbst innerhalb…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 5 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.