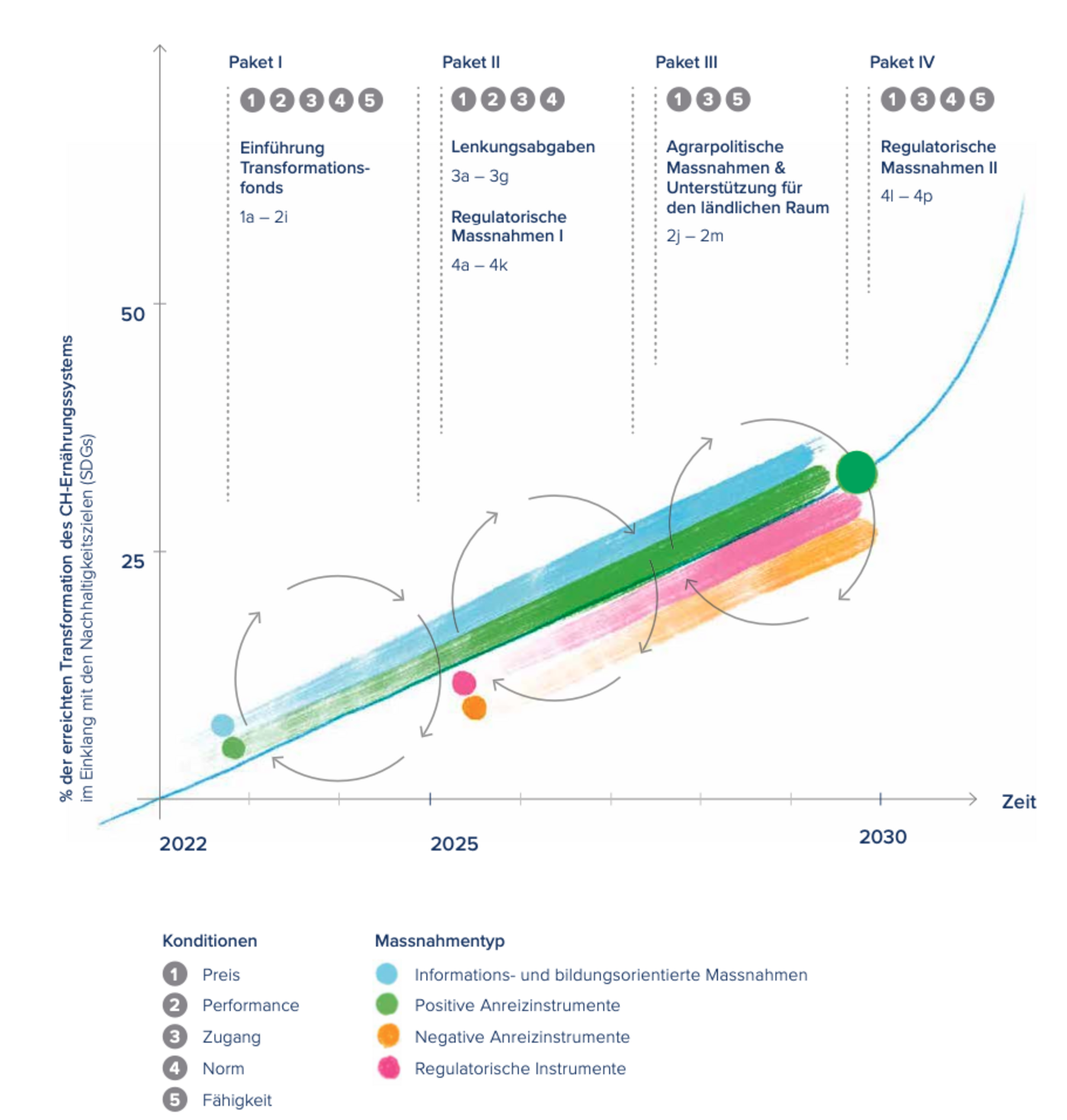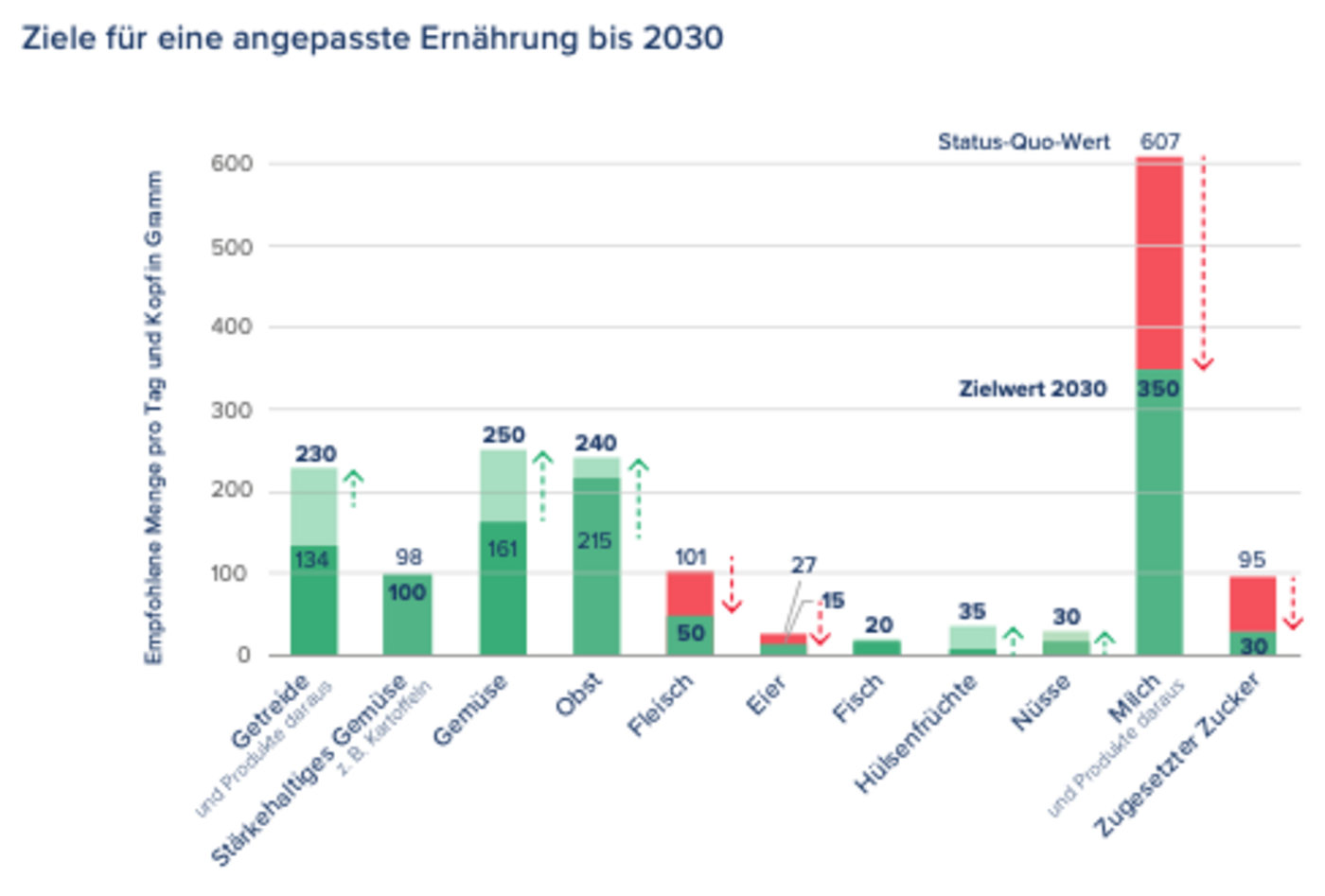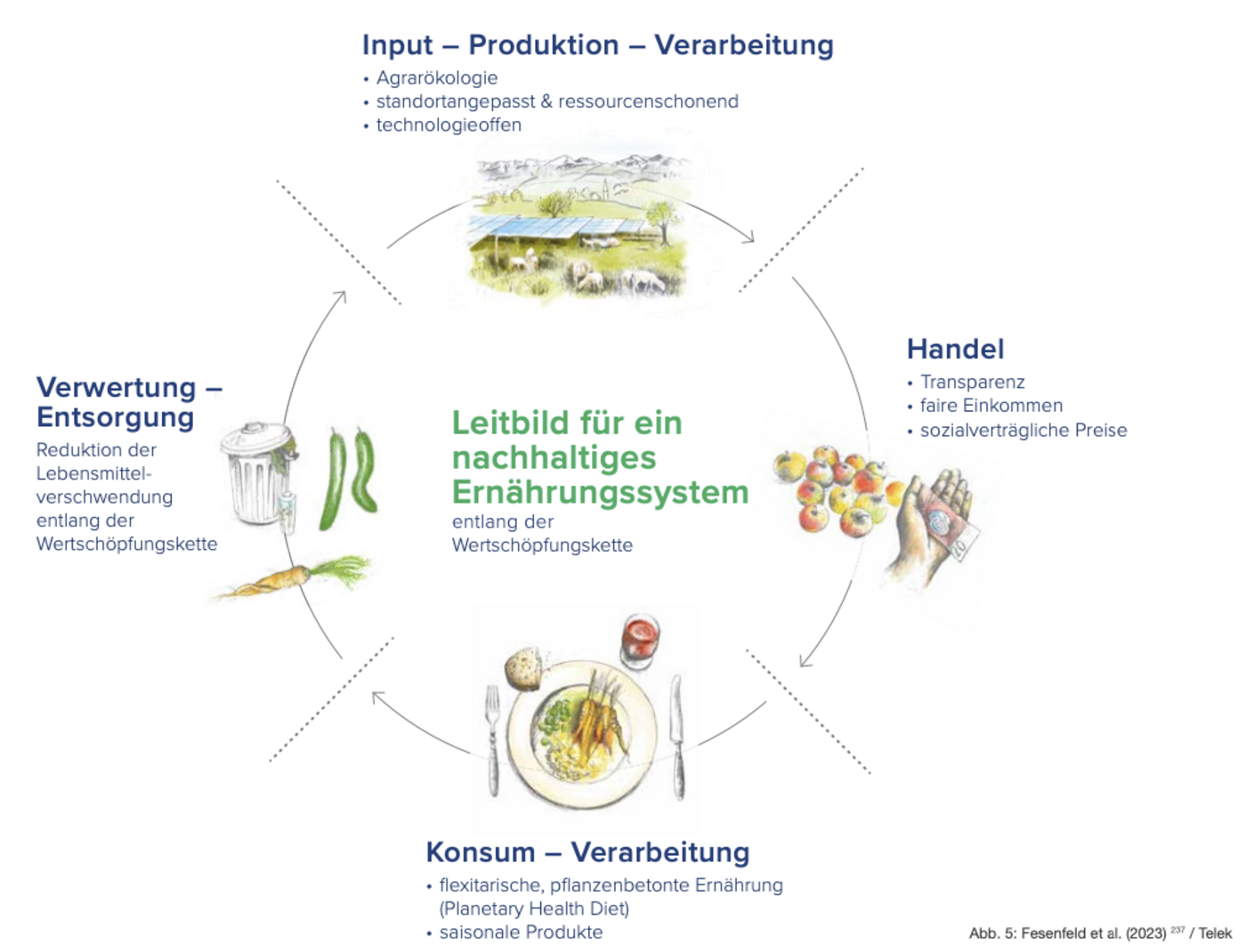Ein grosses Thema wurde am Schweizer Ernährungssystemgipfel in Bern mit grosser Kelle angerührt und von illustren Persönlichkeiten begleitet. Die Frage des Tages ist zugleich jene der Zukunft: Wie gelingt der Wandel der Landwirtschaft, von Handel und Konsum zu einer Form, die langfristig bestehen kann? Es herrschte erstaunlich grosse Einigkeit – bis auf einen entscheidenden Punkt. Die informierte Bevölkerung stimmt…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 5 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.