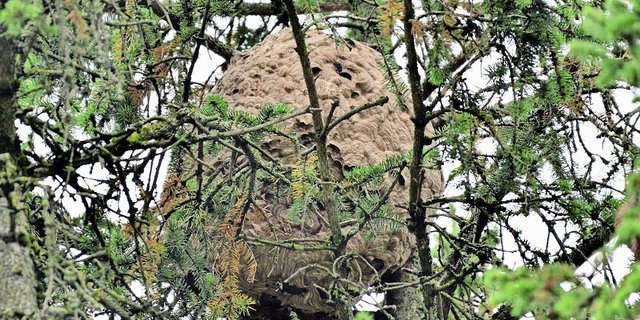Die Baumwollkapseleule (Helicoverpa armigera) ist ein Wanderfalter, der von Süden, Westen und Osten in die Schweiz einfliegt. «In den entsprechenden Grenzregionen haben wir 2025 aktuell die ersten Falterfänge registriert», gibt Cornelia Sauer von Agroscope Auskunft. Seit letztem Jahr unterhält die Forschungsanstalt ein schweizweites Monitoring dieses Schädlings. Früh geschützt 2023 gab es durch die…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 4 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.