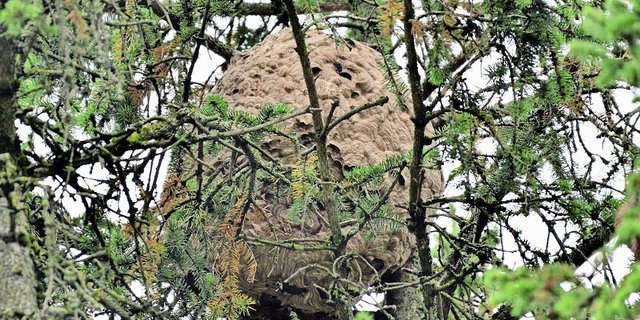«Wir sind es gewohnt, unsere Tiere zu umsorgen, aber wenn dann all die Viren und Schädlinge dazukommen, wird es schwierig», sagte Luzi Tanner aus Winden an der Wintertagung des Verbands Thurgauer Landwirtschaft (VTL). Dabei informierte Kantonstierärztin Astrid Hollberg über Tierseuchen und Florian Sandrini, Leiter Pflanzenschutzdienst Arenenberg, über Quarantäneorganismen. Impfstoffbank aktiviert Die Wintertagung…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 5 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.