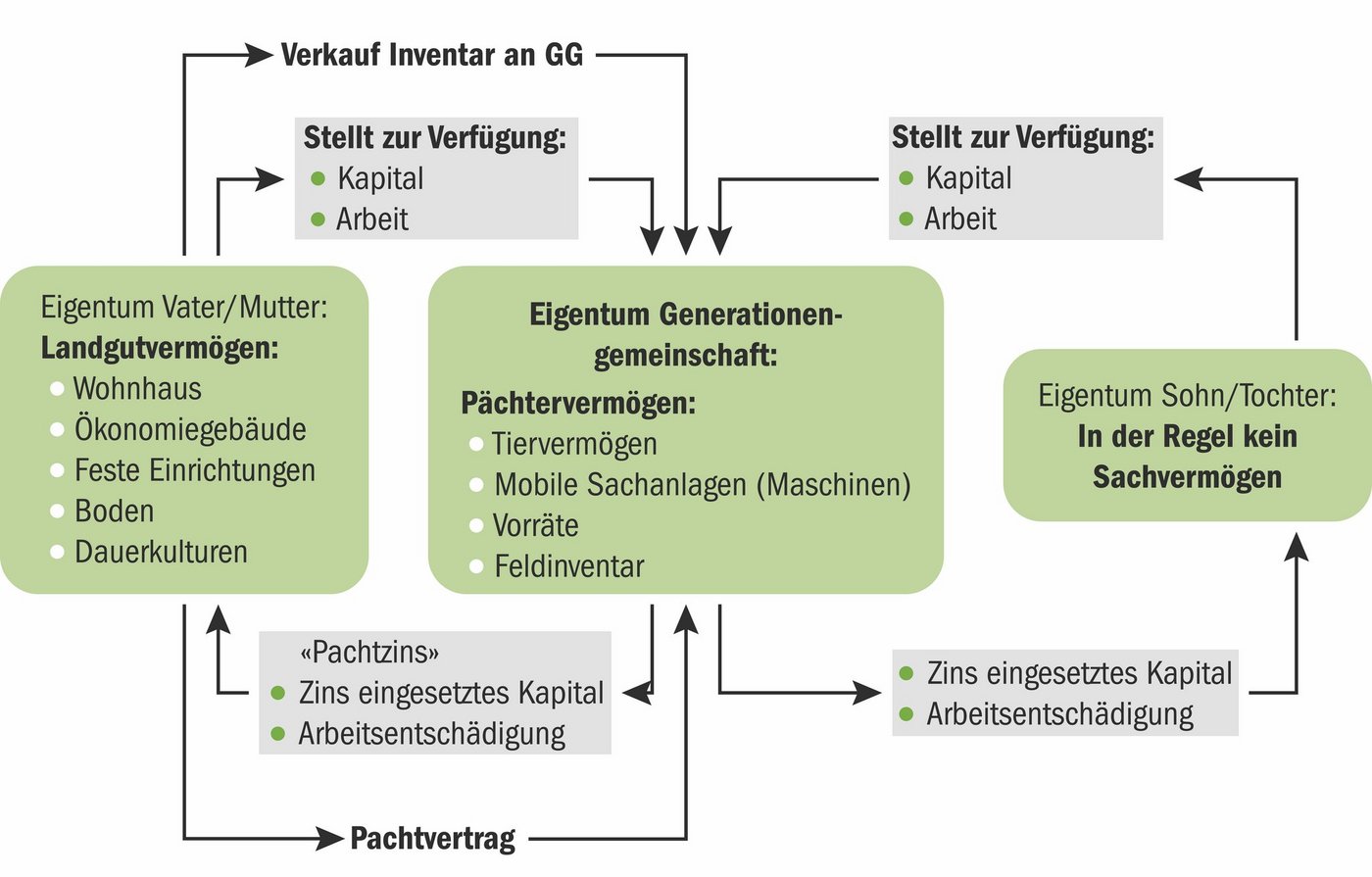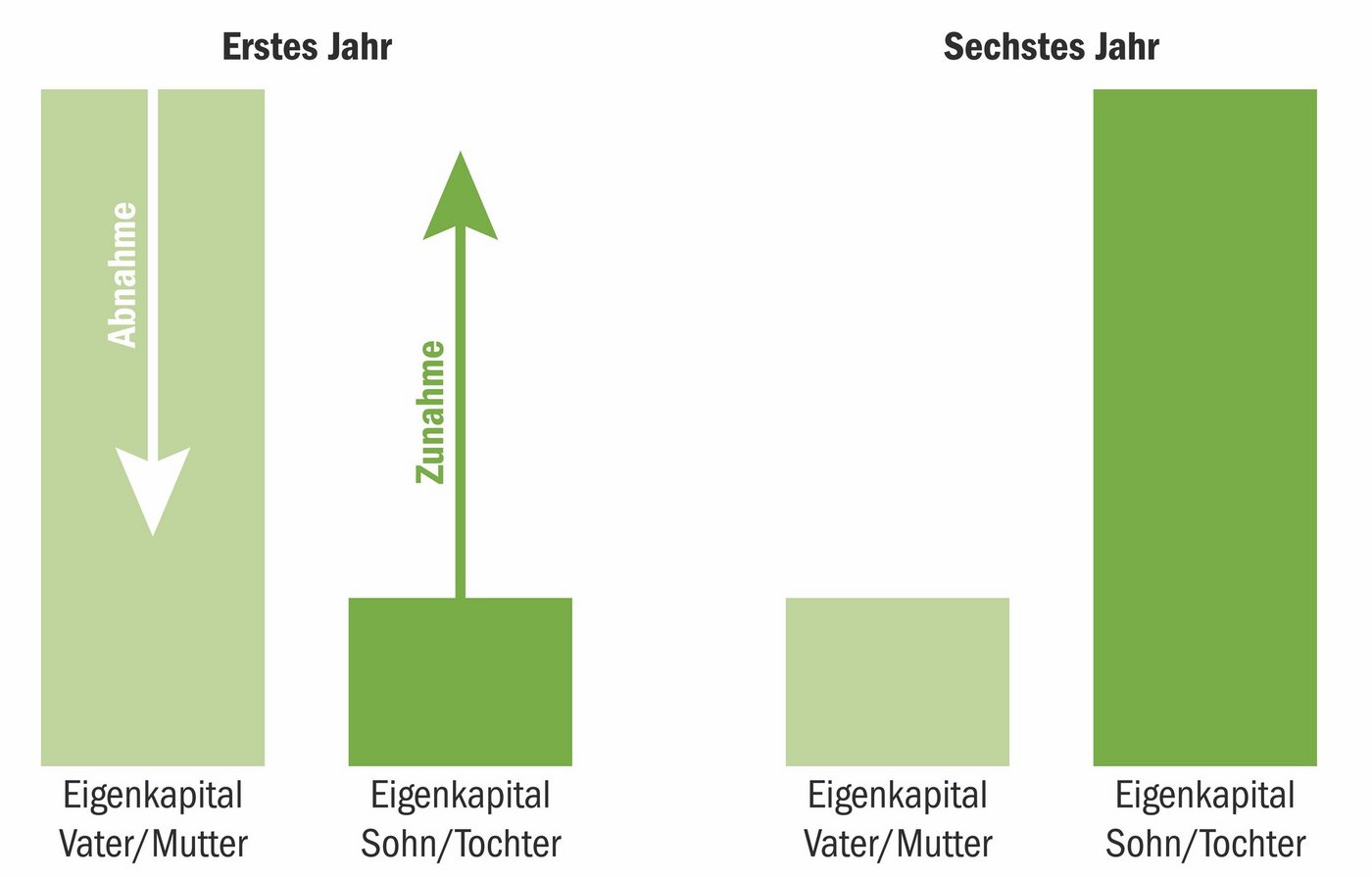Jede Generationengemeinschaft (GG) wird früher oder später aufgelöst. Damit die Auflösung für alle Beteiligten fair ist, muss man sich schon bei der Gründung mit der Auflösung auseinandersetzen. Wir sprechen hier von Stolperfallen, die weitreichende Konsequenzen haben, Verluste für einen Gemeinschafter bzw. eine Gemeinschafterin bedeuten oder sogar das Erbrecht tangieren. Die Gründung einer GG ist ein grosser…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 6 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.