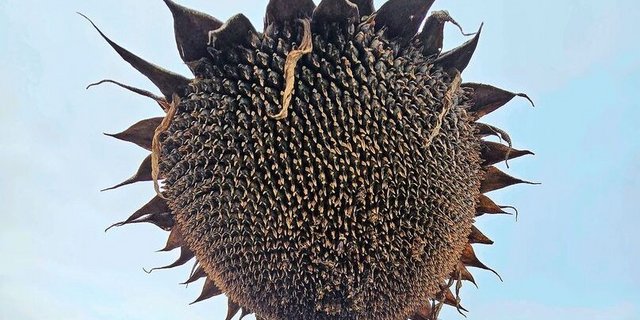Oftmals kommt bei der Stoppelbearbeitung nach Mais ein Mulchgerät zum Einsatz. Die aktuellen Niederschläge können die Bearbeitung des Bodens erschweren. Dem Bodenzustand muss vor der Bearbeitung grosse Beachtung geschenkt werden, um keine Bodenverdichtungen zu riskieren. Stoppeln anrauen und zerkleinern Werden die Stoppeln gemulcht, trägt dies dazu bei, den Maiszünsler zu bekämpfen. Die intensive Bearbeitung raut…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 3 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.