Rund 447’500 Tonnen Fleisch aller Arten (ohne Fisch und Krustentiere) wurden laut Branchenorganisation der Schweizer Fleischwirtschaft Proviande letztes Jahr in der Schweiz konsumiert. Schaf- und Lammfleisch ist eine Nische: Knapp 9’800 Tonnen betrug der Konsum von Schaf- und Lammfleisch. Ins Auge fällt dabei aber der Inlandanteil: Nur rund 40 Prozent des in der Schweiz verkauften Schaf- und Lammfleisches stammt auch von hier. Das bestätigt auch Peppino Beffa, Präsident des Schweizerischen Schafzuchtverbandes (SSZV): «Schweizer Mutterschafbetriebe produzieren pro Jahr rund 250’000 Lämmer für den Fleischverkauf – das deckt die Nachfrage aber kaum. Rund fünf Millionen Lämmer respektive Teile vom Lamm werden jährlich importiert.»
Keine Tradition und fehlendes Knowhow
Trotz guten Voraussetzungen wird das Potential der Schweizer Mutterschafhaltung nicht ausgeschöpft. Das hat vielschichtige Gründe: Laut Christian Gazzarin vom Forschungsbereich Wettbewerbsfähigkeit und Systembewertung des eidgenössischen landwirtschaftlichen Forschungsinstituts Agroscope ist die Struktur der Mutterschafhaltung von vielen kleinen Beständen geprägt. «Die meisten Bestände haben eher Hobby-Charakter, werden eher stiefmütterlich gehalten und sollen neben den Rindern einfach noch die steilen Wiesenborde abgrasen. Richtig professionelle Betriebe mit 100 und mehr Mutterschafen, die einen namhaften Anteil des Haushaltseinkommens aus der Mutterschafhaltung erwirtschaften sind rar», erklärt Christian Gazzarin die Situation in der Schweiz.
Die gleichen Beobachtungen macht auch Peppino Beffa: Die Mitgliedsbetriebe beim SSZV seien in der Tendenz eher kleinere Betriebe mit im Schnitt 20 bis 30 Tieren. Schafhaltung habe in der Schweiz nicht so eine grosse Tradition wie die Rindviehhaltung. Dass Landwirtschaftsbetriebe auf Schafe umstellen, passiere deshalb nicht oft. «Von einem Milchviehbetrieb mit Rindern stellt man auf Mutterkuhhaltung um und nicht auf Mutterschafhaltung», meint Peppino Beffa. Tatsächlich habe die Schafhaltung in der Schweiz immer ein bisschen im Schatten der Rindviehhaltung gestanden und darunter hätte in der Folge auch die Produktivität gelitten, bestätigt Christian Gazzarin: «Der wirtschaftliche Druck, mit Schafen Geld zu verdienen, war schlicht nicht vorhanden.» Deshalb sei vielen Schafhaltern heute gar nicht bewusst, dass bei der Mutterschafhaltung ein viel grösseres Produktivitätssteigerungspotential vorhanden sei als beispielsweise bei der Mutterkuhhaltung.
Kühe und Schafe hätten ausserdem unterschiedliche Ansprüche an die Infrastruktur und beim Handling, fügt Peppino Beffa an. Ein Wechsel von Milchkühen zu Mutterkühen sei deshalb für die meisten naheliegender. Ein Beispiel: «Obwohl die Klauenpflege bei Schafen sicher schneller geht als bei Rindern, macht es doch einen Unterschied, ob man 30 Rindern die Klauen schneidet oder 120 Schafen.»
Zwei Produktionssysteme versprechen Erfolg
Die Ausgangslage für eine wirtschaftliche Schafhaltung ist in der Schweiz sicher herausfordernd. Untersuchungen von Christian Gazzarin zeigen aber, dass gerade Mutterschafhaltung absolut lohnenswert sein kann. Sowohl für intensive wie auch extensive Mutterschafhaltung gibt es ein geeignetes Produktionssystem.
Ein intensives Produktionssystem müsste sich auf Mutterschafhaltung mit ganzjähriger Ablammung konzentrieren, das den Markt auch im Frühling und Sommer mit Fleisch beliefere. Besonders in Tal- und Hügelregionen ohne Alpung sei dies möglich: «Die Futtergrundlagen müssen gut sein und es muss etwas mehr Arbeit pro Mutterschaf eingesetzt werden. Dafür ist der Output viel höher», sagt Christian Gazzarin.
Ein extensives Produktionssystem müsste sich hingegen auf Mutterschafhaltung mit saisonaler Ablammung im Frühling konzentrieren. Bei einem saisonalen und extensiven System müsse der Ablammsaison aber besonders viel Beachtung geschenkt werden: «Denn wenn ein Mutterschaf erst in einem Jahr wieder ablammt, wiegt ein Lammverlust besonders schwer – zudem muss konsequent auf fruchtbare Tiere mit häufigen Zwillingsgeburten gezüchtet werden.» Ein extensives Produktionssystem eigne sich vor allem in Bergregionen mit Alpung. Dabei müsse auf vereinfachte Arbeitsabläufe gesetzt und Direktkosten möglichst minimiert werden.
[IMG 2]
Das Engadinerschaf kann eine gute Ausgangsrasse für eine ideal an den Betrieb angepasste Zucht sein. (Bild ly)
Genetik ist der Schlüssel
Erfolgsversprechende Mutterschafhaltung in der Schweiz ist standortabhängig und muss sich den Gegebenheiten möglichst gut anpassen können. Ob aber auf ein intensives oder extensives Produktionssystem gesetzt wird – Erfolg basiert auf einer guten Zucht. Und genau hier scheinen Schweizer Mutterschafhalterinnen und -halter noch das grösste Aufholpotential zu haben. Das «Superschaf» für den Schweizer Mutterschafbetrieb findet man nämlich nicht im Katalog. Überspitzt könnte man behaupten, dass jeder Betrieb seine eigene Rassenkombination wählen muss: Perfekt auf das Produktionssystem und den Standort sowie die Futtergrundlage des Betriebes angepasst.
«Das genetische Potential muss besser ausgenutzt werden», erklärt Christian Gazzarin. Die grosse Rassenvielfalt bringe es aber mit sich, dass jeder Betrieb die für sich bestgeeignete Kombination finden könne. Auf die Mischung kommt es also an: Am Anfang einer erfolgversprechenden Zucht stehen aber immer möglichst reine und genetisch klar zu unterscheidende Ausgangsrassen. Mit verschiedenen Stämmen kann besser und gezielter auf die jeweiligen Stärken respektive erwünschten Zuchtmerkmale der verschiedenen Schafrassen gezüchtet werden. Ein Texelschaf und ein Engadinerschaf sind beispielsweise aus ganz verschiedenen Stämmen: Ein Engadinerschaf zeichnet sich durch seine hohe Fruchtbarkeit aus, hat aber eine geringere Mastfähigkeit. Das ursprünglich aus den Niederlanden stammende Texelschaf ist eine Fleischschafrasse und zeichnet sich so durch eine gute Mastfähigkeit aus, lammt in der Regel aber nur einmal und saisonal ab. Im Idealfall ist eine Kreuzung aus Texel- und Engadinerschaf also beides – sehr fruchtbar und äusserst mastfähig – aber beide Rassen haben einen geringen Fettansatz, weshalb die Kombination nur bei sehr guten Futtergrundlagen geeignet ist. Bei einer Kreuzung aus unterschiedlichen Stämmen können schlechte Merkmale ausserdem einfacher ausgeschaltet werden und Hybridzüchtungen sind vitaler und sehr wuchsfreudig.
Eine Übersicht über in der Schweiz gehaltene Schafrassen finden Sie hier.
Gut Ding will Weile haben
Die richtige Mischung setze für die Schafhaltungsbetriebe allerdings eine Experimentierphase voraus, die gut und gerne fünf bis zehn Jahre dauern könne, meint Christian Gazzarin. Das gilt vor allem für die Dreirassen-Kreuzung, mit der ein Hybridschaf als Mutterschaf herangezüchet würde. «Weibliche Tiere stellen zwar die eigentliche Produktionsgrundlage dar und müssen eine gute Gesundheit und Fruchtbarkeit aufweisen. Die richtige Anpaarung der männlichen Tiere ist aber genauso wichtig.» Oft werde beispielsweise der Fehler begangen, dass auf schwere, grosse Widder gesetzt werde, deren Abstammung nicht unbedingt von guten Fruchtbarkeitsmerkmalen geprägt ist: An den Schafschauen machten diese grossen kräftigen Widder zwar einen guten Eindruck, gerade diese stammten aber meist aus Einzelgeburten. Wer sich also nun blenden liesse und so einen Widder kaufe, kann durchaus einen – für die Nachzucht – eher «unfruchtbaren» Widder für die Zucht mit nach Hause nehmen, was das Zuchtziel von häufigen Zwillingsgeburten sabotieren kann.
Dasselbe gilt für die Mastfähigkeit: Wer beispielsweise wegen magerem Grundfutter Schwierigkeiten habe, dass die Lämmer die gewünschte Fettklasse erreichen, soll sich eine frühreife Mastwidderrasse suchen, die schneller Fett ansetze. Umgekehrt könne bei einer guten Futtergrundlage oder bei Mutterrassen, die selbst bereits die Anlagen für einen guten Fettansatz mitbringen, auf Widder gesetzt werden, die wenig Fett ansetzen. «Ziel soll es sein, die gewünschte Schlachtkörperqualität möglichst ohne energiereiche Kraftfuttermittel zu erreichen, sondern nur mit der Genetik.» Und das sei tatsächlich möglich: Bei einer gut gezüchteten Hybridrasse sei die Zufütterung von Kraftfuttermittel für die Ausmast nicht mehr nötig – allenfalls beim Mutterschaf selbst, in der ersten Zeit nach der Ablammung.
Viele jüngere Schweizer Betriebe befänden sich momentan in der Experimentierphase für die für sie ideale Hybridrasse. Allerdings sei dies kein Vergleich beispielsweise zu England, dem Mutterland der Schafzucht. Dort gibt es das «Superschaf»: Es sind über Jahrzehnte ausgefeilte Kreuzungen, die aus mehreren Rassen hervorgingen – Drei- bis Vierrassen-Kreuzungen sogar. Die Voraussetzungen für ein Schweizer «Superschaf» – oder eben betriebsindividuelle «Superschafe» – sind in der Schweiz durchaus gegeben. Mit sorgfältiger Züchtung müssen sie aber erst herausgebildet werden.
Und wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind?
Grundsätzlich sei die Spannweite zwischen einer wirtschaftlichen und einer unwirtschaftlichen Mutterschafhaltung sehr weit, zieht Christian Gazzarin Fazit: «Man kann durchaus viel Geld verdienen, wenn das Management top ist – umgekehrt kann man auch vieles falsch machen und entsprechend Geld verlieren.» Aber auch wenn es den Schweizer Mutterschafhalterinnen und -halter gelingen sollte, durch einen möglichst effizienten Arbeitseinsatz hohe Stundenlöhne zu erwirtschaften, bleibt das ganze System marktabhängig. Weil aber viel Lammfleisch importiert wird, ist das Potential in der Mutterschafhaltung noch gross. Das Potential sei aber nur solange gross, wie die Konsumenten bereit seien, auch die Fleischstücke zu verwerten, die weniger populär seien als das Nierstück.
Bei einem Grossteil der Bevölkerung sind nämlich vor allem die Edelstücke wie Lammracks (Lammrücken/Carré) oder Lammchops (Koteletts vom Lammrücken oder Lammkeule) beliebt und entsprechend gefragt. «Die Edelstücke machen aber nur rund 600 Gramm des Lammes aus, die anderen rund 19 Kilogramm sind kaum gefragt und die Bäuerin oder der Bauer hat trotz aktuell guter Marktsituation und guten Preisen Mühe, das ganze Lamm abzusetzen», bedauert auch Peppino Beffa.













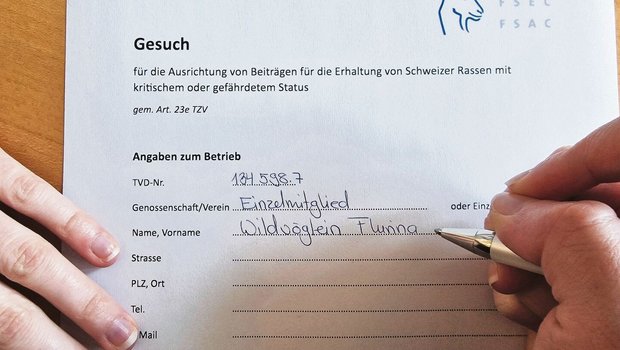



1